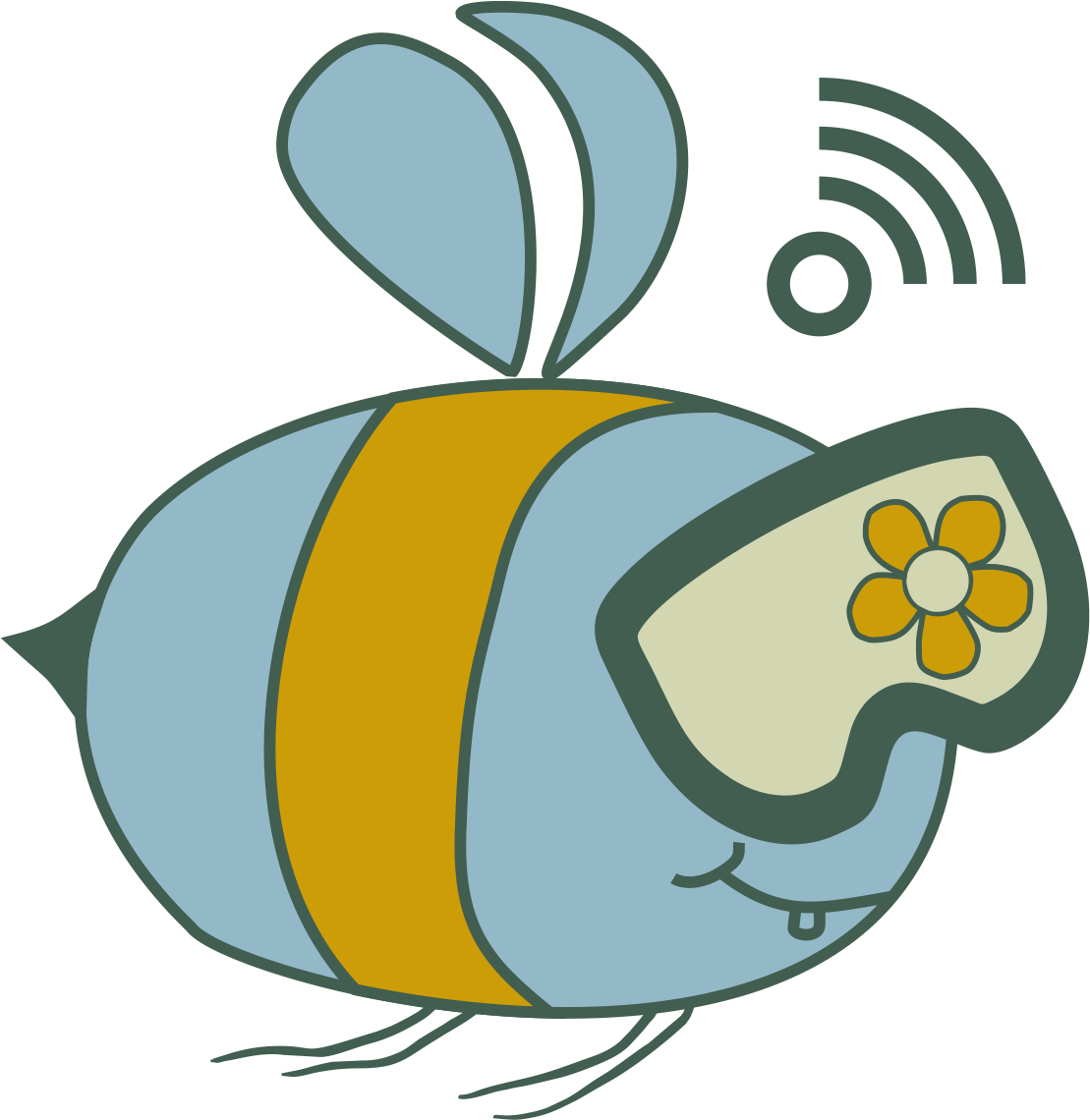Smartphone-Apps für Lehr- und Erlebnispfade – Strategien für eine erfolgreiche Realisierung
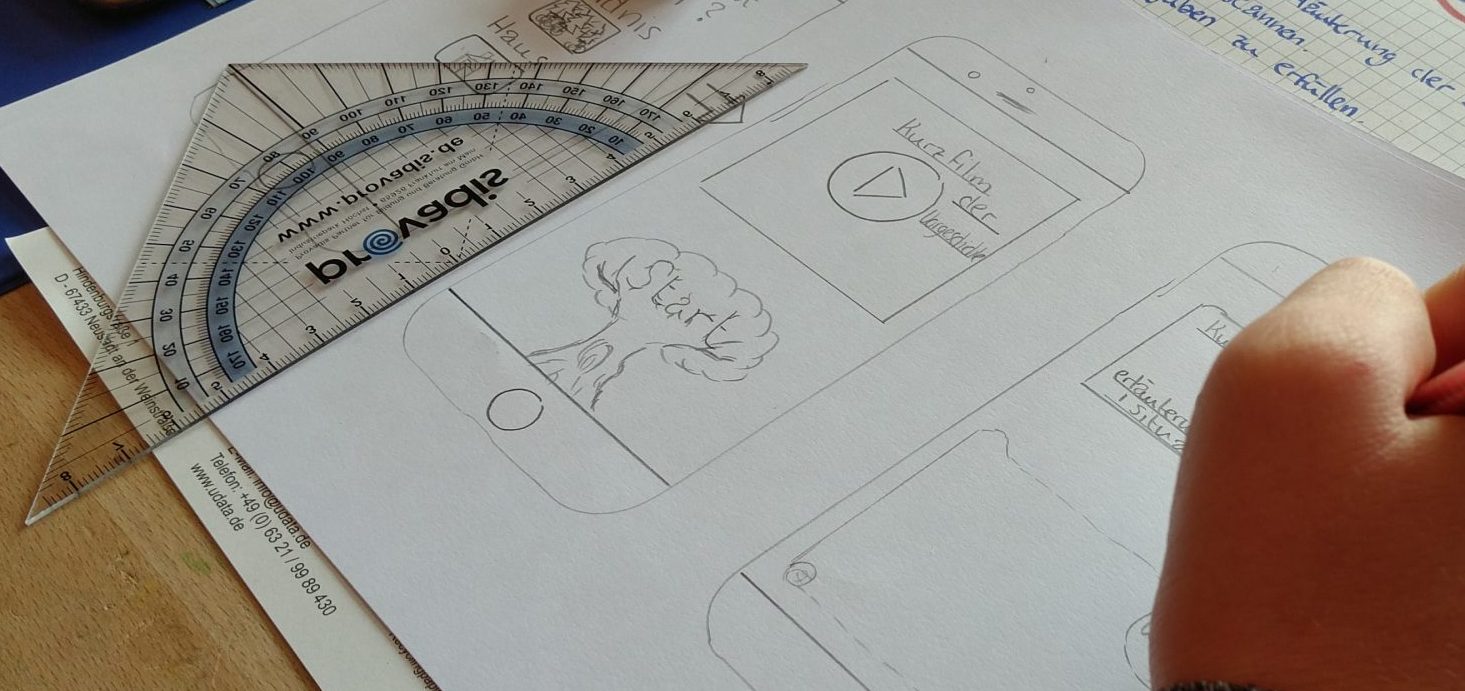
Was macht ein gutes Angebot für das Smartphone aus und welche Techniken lassen sich einsetzen? Hier ist viel Kreativität gefragt. Natürlich müssen auch noch viele weitere Faktoren wie Zeit, Geld und Knowhow beachtet werden. Wenn Sie ein digitales Umweltbildungsangebot für das Smartphone realisieren möchten, kann einiges leicht schief gehen. Denn allzu oft werden Ansätze aus der analogen Welt einfach 1:1 in die digitale Welt übertragen. Doch so einfach ist es oft nicht. In der digitalen Welt müssen viele Dinge neu gedacht und erdacht werden.
In meinem Beitrag „Erlebnispfade in das digitale Zeitalter“ zeigte ich bereits einige der möglichen Fallstricke auf. Doch nun soll es darum gehen, welche Herausforderungen bei der Entwicklung einer routengeführten Smartphone-App zu bewältigen sind. Die möglichen Strategien sollen unter den Aspekten Motivation, Konzeption, Umsetzung, Standort, Bereitstellung und Finanzierung betrachtet werden.
1. Motivation
Machen Sie sich Gedanken, warum Sie das digitale Angebot erstellen und welche Zielgruppen Sie erreichen möchten. Wo soll genau der Mehrwert liegen? Das Argument, technikaffine Jugendliche zu erreichen, genügt nicht. Vielmehr sollten Sie mit dem digitalen Angebot Dinge tun, die mit analogen Techniken überhaupt nicht oder nur schwer zu realisieren sind. Auch ist es wichtig, ob ein bereits bestehendes analoges Angebot ergänzt, erweitert oder ersetzt werden soll. Welche Themen und Inhalte sollen vor allem vermittelt werden? Gibt es neben dem Umweltbildungsaspekt noch weitere Ziele und Synergieeffekte?
2. Konzeption
Beschäftigen Sie sich vorher ausführlich mit den Möglichkeiten, wie ein digitales Natur- und Umweltbildungsangebot sinnvoll gestaltet sein könnte. Es ist schwierig bei null anzufangen. Woran orientiert man sich? Was gibt es schon? Verfallen Sie nicht darauf, bisherige analoge Ansätze 1:1 in die digitale Welt zu übertragen. Vor allem wenn schon ein Lehrpfad vorhanden ist! Denn, warum sollte man diesen Pfad mit einer App abgehen, wenn doch auch alles auf den Tafeln steht?
Ein häufiger Fehler ist, dass man die digitale Variante eines Lehrpfades aufgrund fehlender Platzbeschränkungen völlig überlädt. Vermeiden Sie lange Texte und reduzieren Sie die Inhalte auf das Wesentliche! Eine Station sollte nicht länger als drei Minuten dauern. Die gesamte Tour inklusive Wegstrecke nicht länger als 90 Minuten.
Machen Sie Umfragen bei der Zielgruppe und erkunden Sie bereits bestehende Lösungen. Angebote für Schulklassen müssen möglicherweise anders konzipiert werden als für Einzelbesucher oder Familien. Eine stark unterschätzte Zielgruppe sind z.B. Großeltern mit ihren Enkelkindern!
Tauschen Sie sich mit anderen Akteuren aus, die bereits Erfahrung mit Apps gesammelt haben. Engagieren Sie nach Möglichkeit eine externe Beratung! Konzipieren sie unterhaltsame und abwechslungsreiche Lernspiele. So eröffnen Sie vielfältige Möglichkeiten für eine zielgruppengerechte Vermittlung.
Überlegen Sie sich, wie Sie den Mehrwert noch steigern können. Insbesondere sollte die Interaktion mit der Umwelt maximiert werden. Dies ist die größte Herausforderung. Seien Sie kreativ! Binden Sie bei der Konzeption ggf. die Zielgruppen mit ein, z.B. im Rahmen eines Workshops. Denken Sie daran, dass für die NutzerInnen der Spaß und die Unterhaltung im Vordergrund stehen. Setzen Sie sich mit den verschiedenen Ansätzen zur Gamification auseinander. Binden Sie bereits bei der Konzeption das Marketing mit ein. Insbesondere wenn Sie Gewinnspiele oder Sponsoringoptionen integrieren möchten.
Es gibt auch Baukasten- oder Autorensysteme, bei denen man online eine Quizztour zusammenstellen kann. Diese sind vor allem für Gruppenprojekte interessant, die selbst eine individuelle Tour erstellen möchten. Auch wenn im Rahmen eines Unterrichtsprojektes bereits Gelerntes spielerisch abgefragt oder gefestigt werden soll.
Aufwändige Lösungen mit Virtual oder Mixed Reality sind hingegen dort von Nutzen, wo eine Bereitstellung von Endgeräten möglich ist und eine Wartung der Geräte sichergestellt werden kann. Binden Sie KollegInnen und ExpertInnen ein, die mit den Herausforderungen bei der Entwicklung von digitalen Lernangeboten vertraut sind.

3. Umsetzung
Möchten Sie alles aus der Hand geben oder inhaltlich mitarbeiten? Im Gegensatz zu analogen Formaten sind Umweltbildungsakteure nur selten in der Lage, digitale Angebote selbst zu erstellen. Daher ist eine enge Zusammenarbeit mit einem fachlich kompetenten Dienstleister besonders wichtig, der die Anwendung designt und programmiert.
Beachten Sie, dass digitale Formate anders gedacht und realisiert werden! Die didaktische Wirksamkeit sollte bereits möglichst früh im Entwicklungsprozess geprüft werden. Dies können Sie z.B. mit einer agilen Entwicklung sicherstellen. Bei dieser Vorgehensweise entwerfen Sie zunächst nur einzelne Funktion oder Stationen. Testen Sie diese zusammen mit der Zielgruppe. Lernen Sie aus den Erkenntnissen und optimieren Sie die Elemente und Funktionen entsprechend.
Machen Sie sich mit der Arbeitsweise und der Fachsprache der Produktdesigner und Softwareentwickler vertraut. In der Softwarenentwicklung wird inzwischen überwiegend mit agilen Arbeitsmethoden gearbeitet. Dies ermöglicht eine schnelle und kundengerechte Entwicklung der Software. Allerdings werden die Funktionen erst im Laufe des Entwicklungsprozesses definiert. Dies hat viele Vorteile. Leider wird die agile Vorgehensweise bei Projekten, die eine öffentliche Ausschreibung erfordern, oft erschwert.
Beim Design treffen Sie sehr wahrscheinlich auf Begriffe wie UX, UI und ixD. Die sogenannte User Experience (UX) adressiert an die Emotionen bei der ansprechende und leicht verständliche Funktionen sowie die Bedürfnisse des Anwenders im Vordergrund stehen. Das User Interface (UI) ist hingegen die Schnittstelle zwischen App und Benutzer aus der Perspektive des Gerätes (z.B. Menüführung, Textdesign, Inhalt und Konsistenz. Mit dem Interaction Design (IxD) werden beide Bereiche zusammengeführt, d.h. es werden Nutzerinteraktion von technischer und emotionaler Seite gesamtheitlich analysiert und optimiert. Letzteres entscheidet wesentlich darüber, ob die App von der Zielgruppe angenommen wird. Vergessen Sie nicht die aktuellen gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz und die Barrierefreiheit!
| Wasserfall | Agil | |
|---|---|---|
| Projektmanager | – Fachlicher Lead | – Mediator – Kommunikator |
| Entwicklungsteam | – Spezialisten – Arbeiten nach Vorgabe | – Teamarbeit – enge Abstimmung |
| Kommunikation | – Initialbriefing – Feedback und Freigabe | – enge Einbindung und Abstimmung – enge Feedbackzyklen |
| Vorteile | – klare Abgrenzung – einfache Planung und Kontrolle – einfache Gestaltung des Vertragswerkes | – höhere Flexibilität – schnelle Umsetzung von Inkrementen (MVPs: Minimial Valuable Products) – mehr Freiräume – höhere Transparenz |
| Nachteile | – Schätzung des tatsächlichen Arbeitsaufwandes sehr schwierig – Akzeptanz der Zielgruppe ist erst nach Launch klar – Änderungen der Rahmenbedingungen oder Integration neuer Ideen im Entwicklungsprozess kaum mehr möglich | – hoher Kommunikationsaufwand – höherer Arbeitsaufwand für den Aufraggeber – Vertragswerk schwieriger zu gestalten |
4. Standort
Wählen Sie einen geeigneten Standort oder Route aus. Analysieren Sie, welcher Mehrwert dort mit einem digitalen Angebot erreicht werden kann. Ideal sind Orte die stark frequentiert sind, es jedoch erst wenige (auch anloge) Angebote gibt. Auf einem Festival, im Zoo oder in einem Vergnügungspark machen digitale Angebote nicht immer Sinn. Wenn, dann sollten diese einen überragenden Mehrwert gegenüber den analogen Angeboten bieten. Das gleiche gilt für sehr abgelegene Standorte. Diese werden vor allem von Menschen besucht, die gerade die Ruhe und Abgeschiedenheit schätzen. Die digital-affine Zielgruppe wird man dort nicht so leicht erreichen. Auch Stadtparks und Fußgängerzonen oder das Umfeld von Schulen können für Natur- und Umweltbildungsangebote ideal sein.
Wenn Sie GPS-Funktionen zur Standortsbestimmung einsetzen möchten, bedenken Sie, dass im Wald und Innenstadtbereich Genauigkeit der Positionsbestimmung stark eingeschränkt sein kann. Meist müssen Fehler bis zu 20 Metern toleriert werden. In engen Tälern oder zwischen hohen Gebäuden kann es auch komplett ausfallen. Alternativ können Sie mit Nummern-, QR- Codes oder Bluetooth-Beacons arbeiten. Vermeiden Sie Funktionen, die eine kontinuierliche Online-Anbindung benötigen. Insbesondere im Wald könnten dann Verbindungsprobleme auftreten.
5. Bereitstellung
Unterschätzen Sie nicht den Aufwand, der mit der Bereitstellung eines digitalen Angebotes einhergeht. Denn Hinweise auf Infotafeln, Webseiten und Flyern werden von der technikaffinen Zielgruppe weniger wahrgenommen. Eigenständige Werbeangebote mit Tafeln, Flyern und einer suchmaschinenoptimierten Landingpage erreichen zusätzliche Aufmerksamkeit. Stellen Sie immer den Mehrwert mit dar! Entwickeln Sie publikumswirksame Events und Wettbewerbe, nutzen Sie Social Media, schalten Sie zielgruppengerechte Werbeangebote. Animieren Sie die NutzerInnen über ihr Angebot zu berichten. Verknüpfen Sie Aktionen in der App mit realen Angeboten (Preise, Gutscheine, etc.).
Der Zugang zur App selbst sollte möglichst unkompliziert sein. Ein direkter (Kurz-)Link zum Play- oder AppStore von der Infotafel, Webseite oder Flyer sind dafür Voraussetzungen. Auch in den Sozialen Medien sollten die Links zum Download der App prominent im Vordergrund sein. Registrierungen oder Bezahlschranken halten die meisten Menschen davon ab, die App zu nutzen.
Werbung sollte soweit wie möglich vermieden oder nur sehr dezent platziert werden. Sie darf nicht die Glaubwürdigkeit der Bildungsinhalte unterminieren. Bieten Sie nach Möglichkeit ein kostenloses und schnelles W-LAN, zumindest am Startpunkt zum Download der App an. Auch dort sollte der Zugang ins Netz so einfach wie möglich sein.
Ein erfolgreiches Angebot lässt sich nicht in Downloadzahlen bewerten. Sie spiegeln nicht wieder, ob die gesamte Route durchgespielt wurde und ob ein sich bei den NutzerInnen ein Zugewinn an Wissen eingestellt. Zwar gibt es Tools, mit denen sich das Nutzungsverhalten einer App genau verfolgen lässt, jedoch sind diese nur schwer mit dem Datenschutz zu vereinbaren. Werden diese genutzt, müssen beim Start der App diese Tracking-Funktionen durch den Nutzer bestätigt werden. Dies kann abschreckend wirken. Hilfreicher sind freiwillige Feedbackmöglichkeiten, z.B. über Bewertungen in den Stores. Noch besser sind eigene anonym gestaltete Abfragen in der App, da so aussagekräftige Feedbacks eingeholt werden können. Auch wiederkehrende Veranstaltungen können dazu genutzt werden, um Rückmeldungen zu erhalten. Digitale Touren, die ohne spezielle Events werktags von ein bis fünf Personen und an Wochenendtagen von bis zu 10 Personen gespielt werden, können bereits als sehr erfolgreich bezeichnet werden.
6. Finanzierung
Digitale Angebote sind bereits für wenig Geld zu bekommen. Mit Baukastensystemen lassen sich relativ einfach routengeführte Touren erstellen. Doch auch hier müssen vorher die Inhalte gut durchdacht werden. Die Interaktionsmöglichkeiten sind jedoch stark eingeschränkt und lassen nur wenige Variationsmöglichkeiten zu. Für individuelle Apps müssen Kosten veranschlagt werden, die mindestens im unteren 5-stelligen Bereich liegen. Hochwertige Apps können durchaus bis in den unteren 6-stelligen Bereich gehen. Beachten Sie, dass die Kosten nicht nur für die Programmierung, sondern auch für Design, Testläufe und Bewerbung anfallen. Auch digitale Produkte müssen gewartet werden. Inhalte müssen verändert, programmtechnische Anpassungen vorgenommen und Fehler behoben werden, wenn z.B. neue Smartphonemodelle und Updates der Betriebssysteme erfolgen.